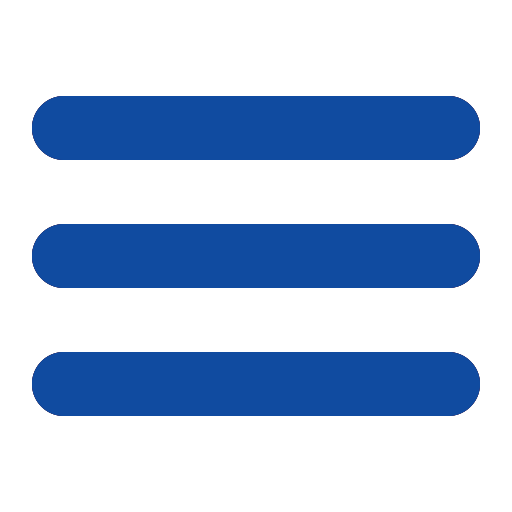Sie befinden sich hier:
- Startseite
- Suchtprävention
Fachstelle für Suchtprävention
Die Fachstelle für Suchtprävention widmet sich der Vernetzung und methodischen Unterstützung vorbeugender Maßnahmen im gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz.
Unsere Mitarbeiterin Antonia Schmitt, Bachelor of Science im Studiengang Gesundheitsförderung mit praktischen Erfahrungen auch aus der Fachstelle Prävention in Frankfurt am Main, stellt hier ihre Angebote vor.
Kontakt
drobs Mansfeld-Südharz
Fachstelle für Suchtprävention
Antonia Schmitt
Bahnhofstr. 33
06526 Sangerhausen
fon: (03464) 34 23 11
mobil: (01522) 4673221
fax: (03464) 34 23 21
mail: aschmitt@paritaet-lsa.de
NEWS
Tag der Medienkompetenz
Auch dieses Jahr gab es wieder den Tag der Medienkompetenz. Zu diesem Tag ruft das Netzwerk Medienkompetenz Sachsen-Anhalt auf, um auf die Medienbildung und Medienpädagogik aufmerksam zu machen. Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz wird rund um das Thema Medien, Medienbildung und -kompetenz gearbeitet. Das lokale Netzwerk „Digital in MSH“, vom hiesigen Präventionskreis, beschäftigt sich auch stark mit diesen Themen.
Während Corona wurden die Schulen zweimal pandemiebedingt geschlossen. Das lokale Netzwerk „Digital in MSH“ hat zwei Befragung zur Lernsituation, während diesen Zeiten, durchgeführt. Teil dieses Netzwerks sind Vertreter*innen der drobs (Fachstelle für Suchtprävention), der Netzwerkstelle für Schulerfolg, des Jugendamts, des TheO´door, des KKJR e.V. und des CJD Sachsen-Anhalt.
Bei der 2. Befragung wurden zu den Schüler*innen auch Lehrkräfte befragt. Es haben 393 Schüler*innen, im Alter von sechs bis 19 Jahren, und 54 Lehrkräfte teilgenommen. 62% der Teilnehmenden waren weiblich. Es wurden alle Schulformen befragt und die Auswertung erfolgte antwortbasiert und nicht personenbasiert.
Die wichtigsten Erkenntnisse der zweiten Befragung, welche sich auf den Zeitraum Dezember 2020 bis Januar 2021bezog, wollen wir hier zusammenfassend der Öffentlichkeit zugänglich machen und somit einen Beitrag zur Optimierung und Bewertung des Distanzlernens leisten. Dabei ist es unverzichtbar auch auf verschiedene Rahmenbedingungen, wie z.B. Verfügbarkeit von Geräten bei den Schüler*innen, einzugehen. Durch die Abfrage der Rahmenbedingungen und weitere Ergebnisse kann indirekt auf die Beantwortung der Frage nach Chancengleichheit bei den Bildungschancen geschlossen werden. Wenn Schüler*innen gezwungen sind am Smartphone digital zu lernen, kann man von wenig optimalen Lernbedingungen ausgehen, inkl. vermutbarer schlechterer Resultate.
Grundschule
Im Folgenden werden wir beispielhaft auf einzelne Besonderheiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten vergleichbarer Ergebnisse aus beiden Befragungen bei den Grundschulen eingehen:
An der ersten Umfrage nahmen 112 Grundschüler*innen und an der zweiten Umfrage 107 Grundschüler*innen teil.
1. Technik
Fast ein Drittel der befragten Schüler*innen gab an, dass sie einen Laptop/PC gebraucht hätten und immer noch verfügte über ein Viertel über keinen Drucker. Besondere Schwierigkeiten gab es bei der Bedienung der Technik und unverändert bei vorhandenen schlechten Internetverbindungen.
2. Rolle der Lehrer*innen
Kontakt mit den Lehrkräften fand bei knapp einem Drittel unverändert über Emailkontakt statt, der Kontakt über Videokonferenzen nahm um 11% (auf 12%) zu. Problematisch ist, dass immer noch 15% der Befragten gar keinen Kontakt zu ihren Lehrer*innen hatten. Dadurch gaben fast ein Drittel an, dass die besondere Schwierigkeit beim häuslichen Lernen darin bestand, dass kaum bzw. kein Kontakt zu den Lehrkräften bestand. Fast unverändert klagte knapp ein Fünftel über zu viele Aufgaben.
3. Lernsituation
Der Großteil der Befragten konnte die Aufgaben nur mit Unterstützung lösen (Umfrage 1-70%; Umfrage 2-77%), diese Unterstützung erhielten sie zu 84% aus den Reihen ihrer Familien, 6% durch Lehrer*innen. Weiterhin hätten sich viele Schüler*innen, wie schon in der ersten Umfrage, Antworten zu erledigten Aufgaben (18%) und allgemein mehr Unterstützung durch Lehrer*innen (21%) gewünscht.
Sekundarschulen
An der ersten Umfrage nahmen 107 Sekundarschüler*innen und an der zweiten Umfrage 54 Sekundarschüler*innen teil.
1. Technik
Zum häuslichen Lernen nutzte fast ein Drittel (31%) das Smartphone, nur ein Viertel verfügte über einen PC/Laptop. Daher gab auch ein fast ein Drittel (27%) an, dass ein PC/Laptop benötigt worden wäre, weiterhin hätte über ein Fünftel einen Drucker gebraucht. Besondere Schwierigkeiten hatte knapp ein Viertel (24%) mit einer unzureichenden Internetanbindung.
2. Rolle der Lehrer*innen
Der Kontakt zu den Lehrer*innen über Videokonferenzen nahm um 17% zu (auf 18%). Der Anteil der Schüler*innen ohne jeglichen Kontakt nahm deutlich von 12 auf 6 % ab. Dennoch gaben über ein Viertel (26%) an, durch fehlenden oder unzureichenden Kontakt mit den Lehrer*innen besondere Schwierigkeiten im Homeschooling gehabt zu haben.
3. Lernsituation
Ein deutlicher Zuwachs bei der Aufgabenverteilung an die Schüler*innen über Lernplattformen (von 32 auf 63 ) ist festzustellen. Knapp die Hälfte der Schüler*innen (46) benötigten bei der Bewältigung der Aufgaben Unterstützung, diese wurde zu 54% durch die Familie und zu 7% durch Lehrer*innen gewährt. Für besseres Lernen daheim hätte sich ein Fünftel der Befragten Rückmeldungen der Lehrkräfte und Hilfe bei der Einteilung der Aufgaben (18%) gewünscht.
Ergebnisse der Lehrer*innenbefragung
Über ein Drittel (39%) gaben an, dass der Mehraufwand der schulischen Arbeit um mehr als zwei Stunden täglich stieg. Unterstützung bei der digitalen Unterrichtsgestaltung erhielten 50% von Kolleg*innen, ein Viertel von der Schulleitung und 15% durch die Familie. Schwierigkeiten bei der eigenen digitalen Arbeit durch eine unzureichende Internetanbindung hatten 30%. Zwei Drittel hatten im letzten Jahr Fortbildungsangebote zu digitaler Unterrichtsgestaltung genutzt.
Danke für Ihr Interesse.
Wenn Sie noch Ideen für weitere Online-Elternabende haben, tragen Sie diese gerne hier: Idee für weitere online-Elternabende* ein.